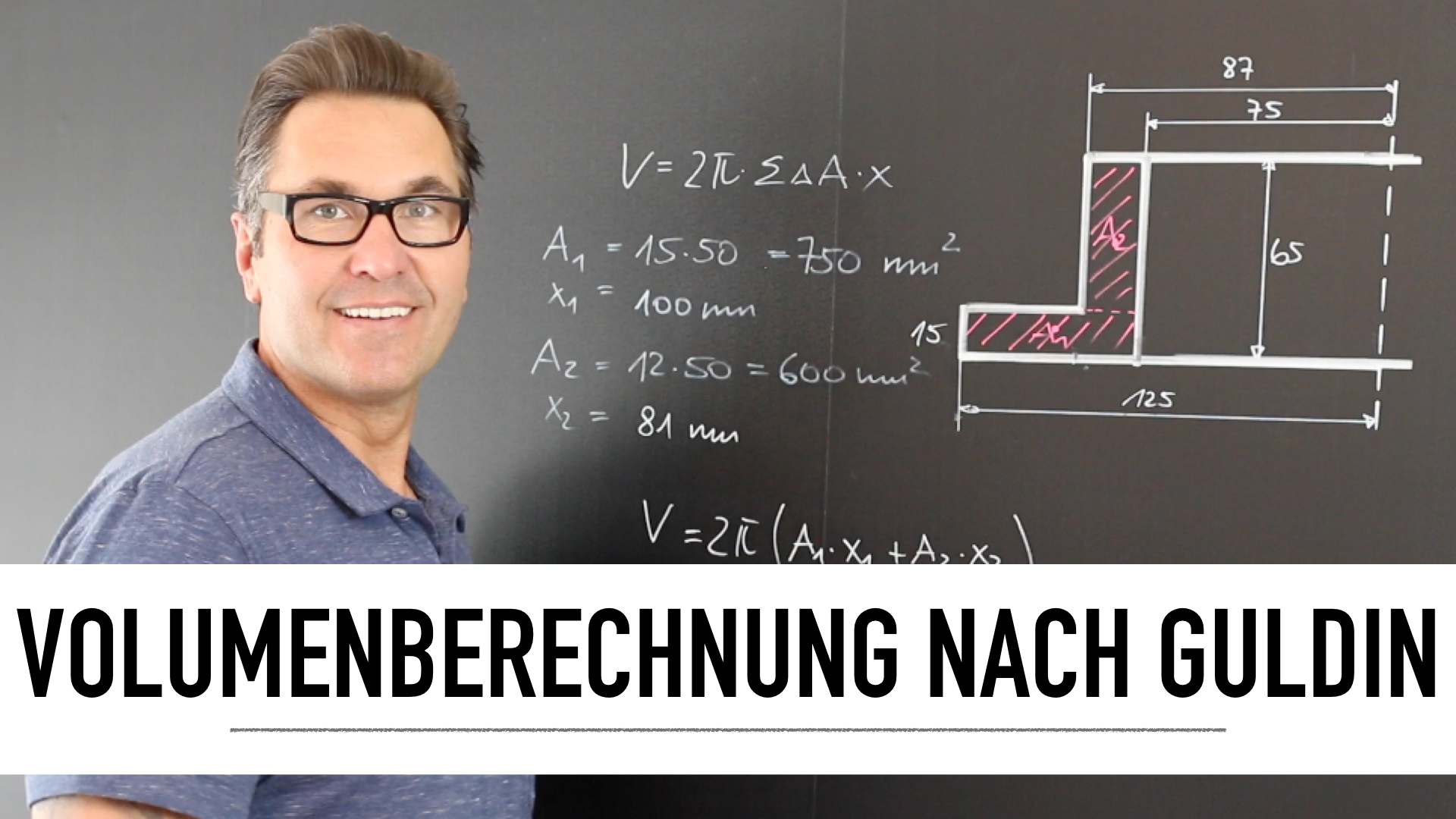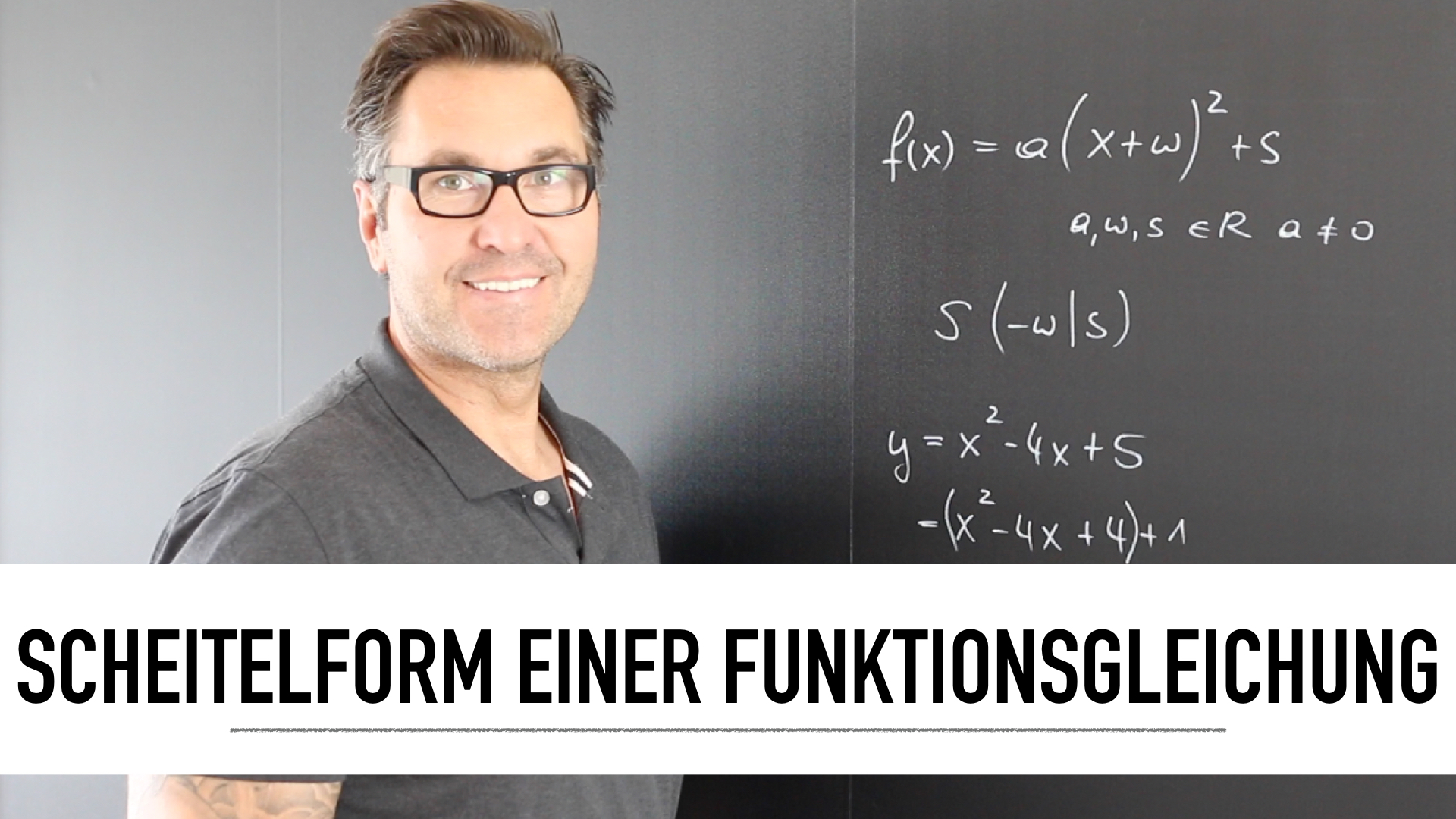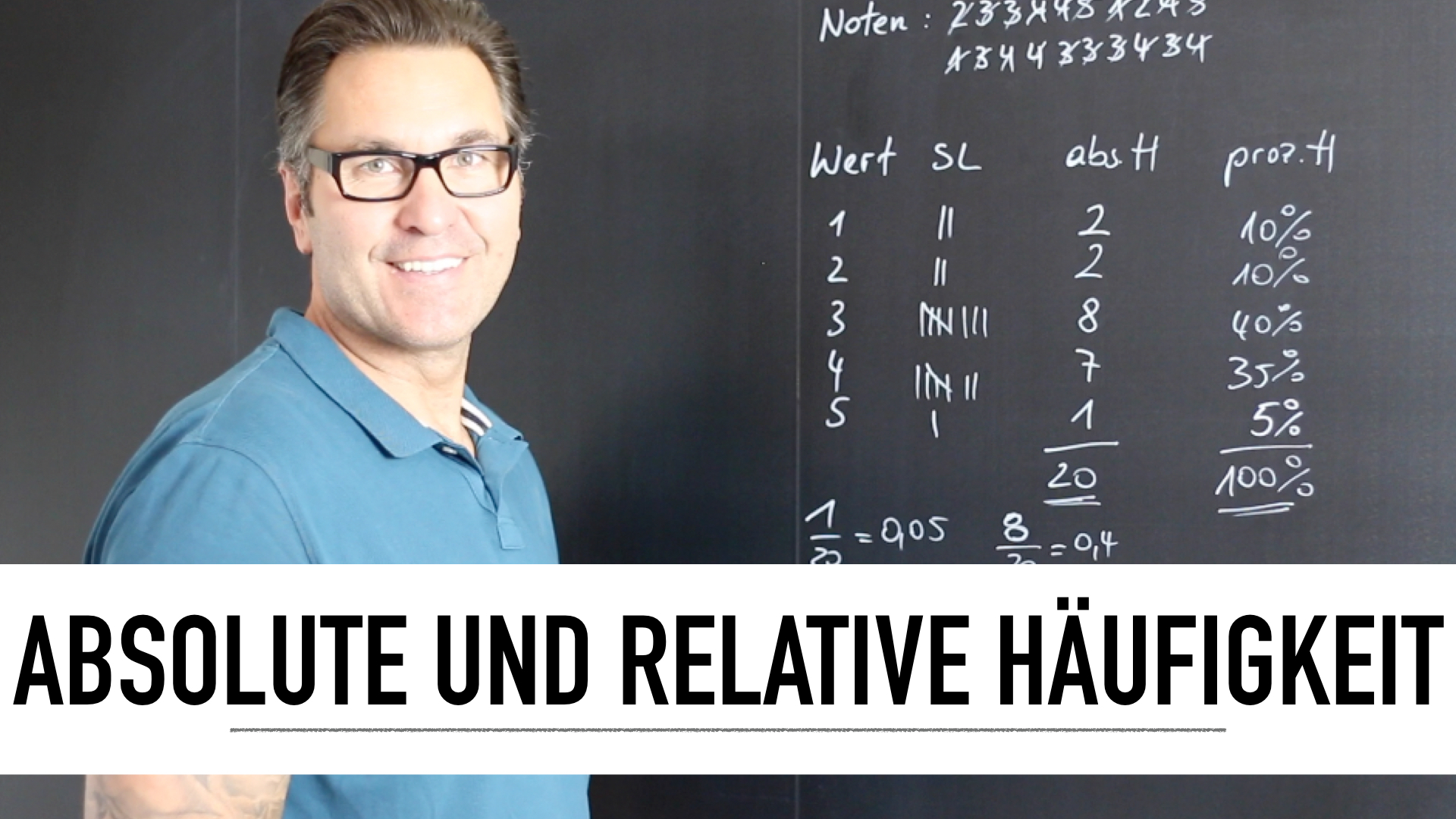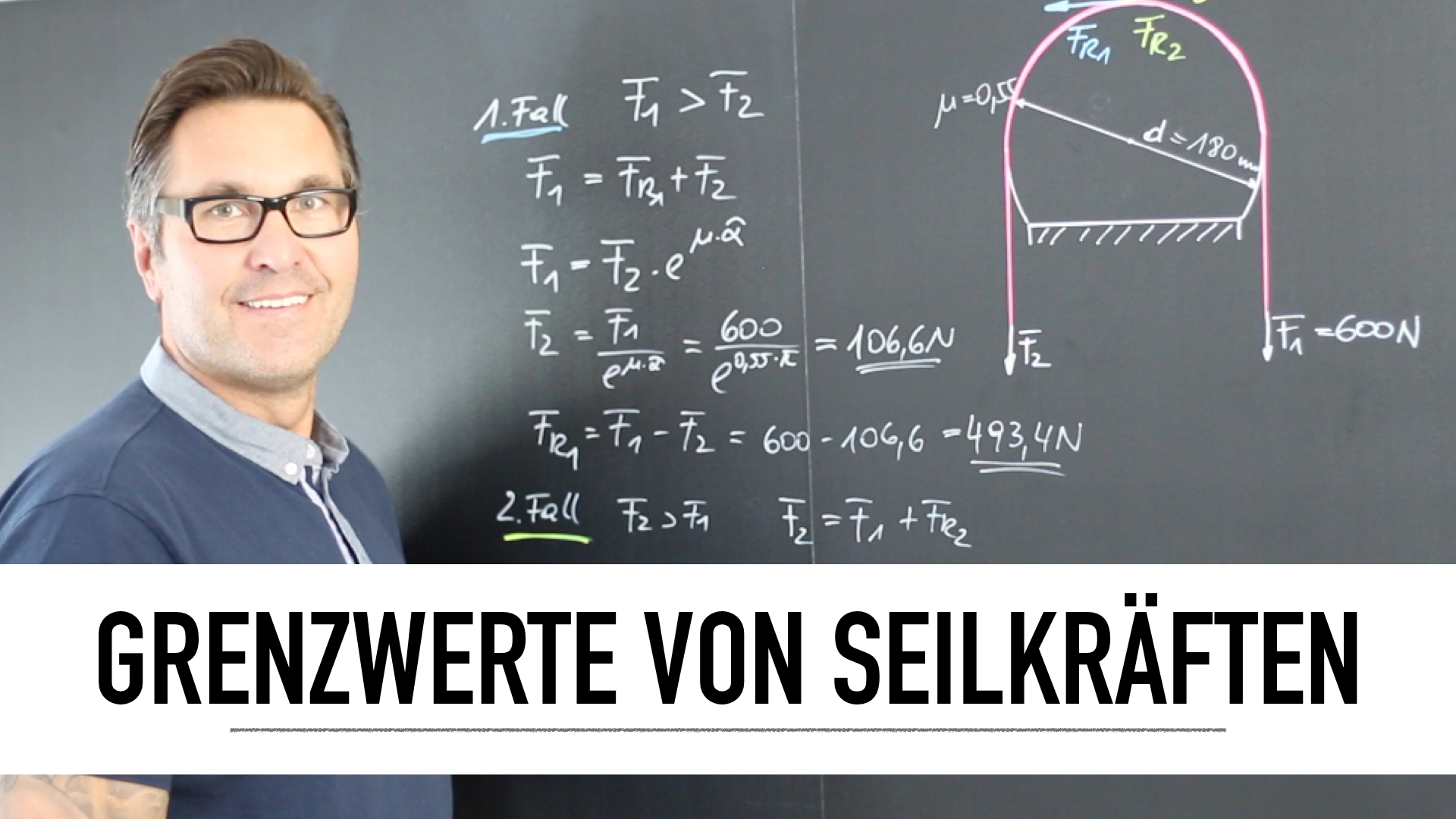Was ist das uneigentliche Integral?
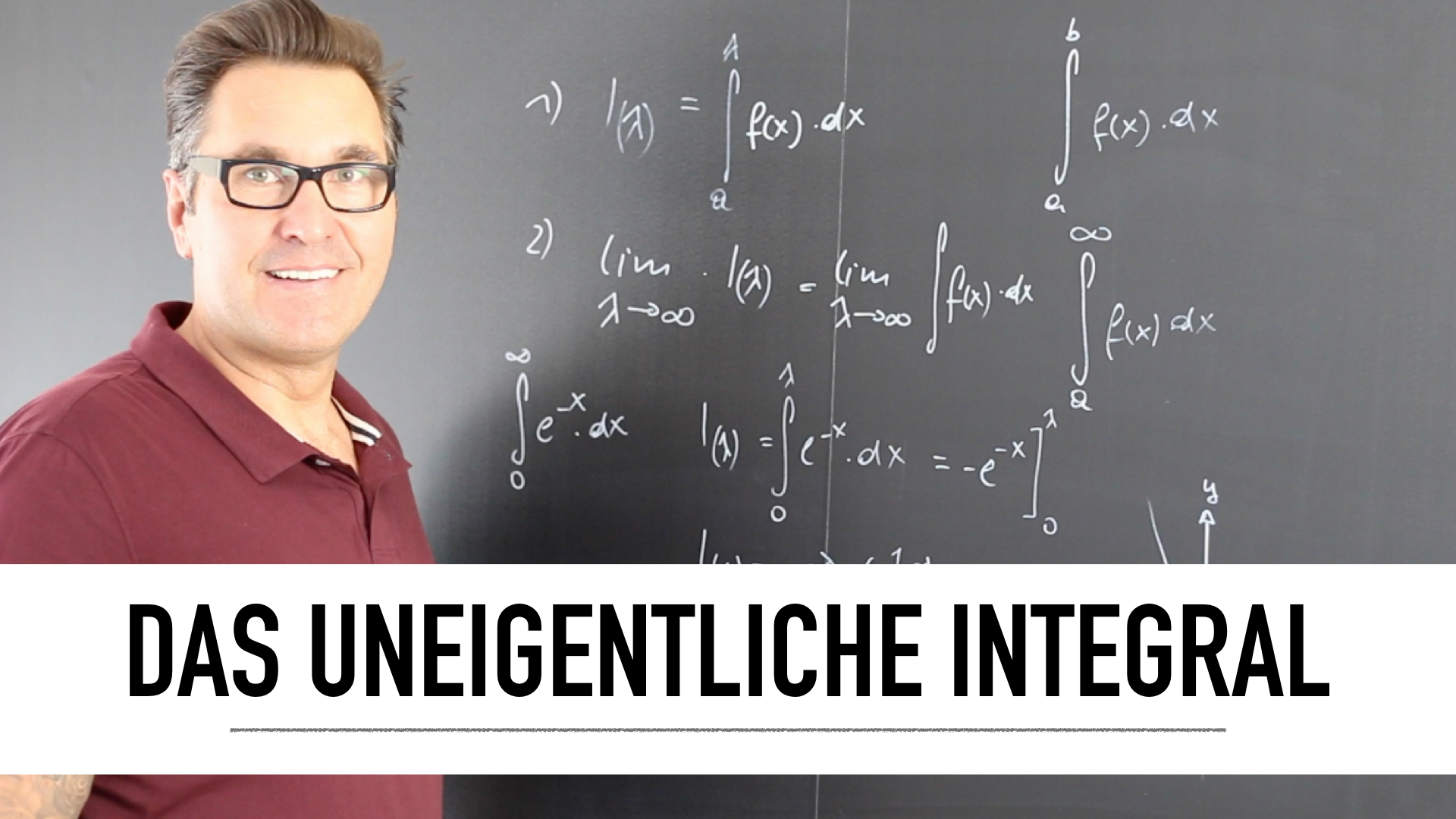
Das uneigentliche Integral ist ein Begriff aus dem mathematischen Teilgebiet der Analysis. Mit Hilfe dieses Integralbegriffs ist es möglich, Funktionen zu integrieren, die einzelne Singularitäten aufweisen oder deren Definitionsbereich unbeschränkt ist und die deshalb im eigentlichen Sinn nicht integrierbar sind.
Ein uneigentliches Integral kannst du als Erweiterung des Riemann-Integrals, des Lebesgue-Integrals oder auch anderer Integrationsbegriffe verstehen. Oftmals wird es allerdings im Zusammenhang mit dem Riemann-Integral betrachtet, da insbesondere das (eigentliche) Lebesgue-Integral schon viele Funktionen integrieren kann, die nur uneigentlich Riemann-integrierbar sind.
Der Grund für das uneigentliche Integral ist
Es gibt zwei Gründe, warum man uneigentliche Integrale betrachtet. Zum einen möchte man Funktionen auch über unbeschränkte Bereiche integrieren, beispielsweise von −∞ bis ∞
Dies ist mit dem Riemann-Integral ohne weiteres nicht möglich. Uneigentliche Integrale, die dieses Problem lösen, nennt man uneigentliche Integrale erster Art. Außerdem ist es auch von Interesse, Funktionen zu integrieren, die auf dem Rand ihres Definitionsbereichs eine Singularität haben. Uneigentliche Integrale, die das ermöglichen, nennt man uneigentliche Integrale zweiter Art. Es ist möglich, dass uneigentliche Integrale an einer Grenze uneigentlich erster Art und an der anderen Grenze uneigentlich zweiter Art sind. Jedoch ist es für die Definition des uneigentlichen Integrals unerheblich, von welcher Art das Integral ist.
Du hast bereits bestimmte Integrale kennengelernt. Diese kannst du mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung berechnen. Dabei ist das Intervall abgeschlossen.
Bei einem uneigentlichen Integral sind
- entweder die obere Integrationsgrenze ∞ und / oder die untere −∞
- oder die Funktion an einer der Integrationsgrenzen ist nicht definiert.
Im folgenden Video zeige ich dir, wie du ein uneigentliche Integrale berechnen kannst. Das Vorgehen ist dabei jedes Mal gleich.
- Du ersetzt die Integrationsgrenze ±∞ beziehungsweise die, an welcher die Funktion nicht definiert ist, durch eine variable Grenze.
- Du erhältst so einen Flächeninhalt, welcher von dieser variablen Grenze abhängt.
- Zuletzt bildest du den Grenzwert entsprechend der Grenze, welcher substituiert wurde.