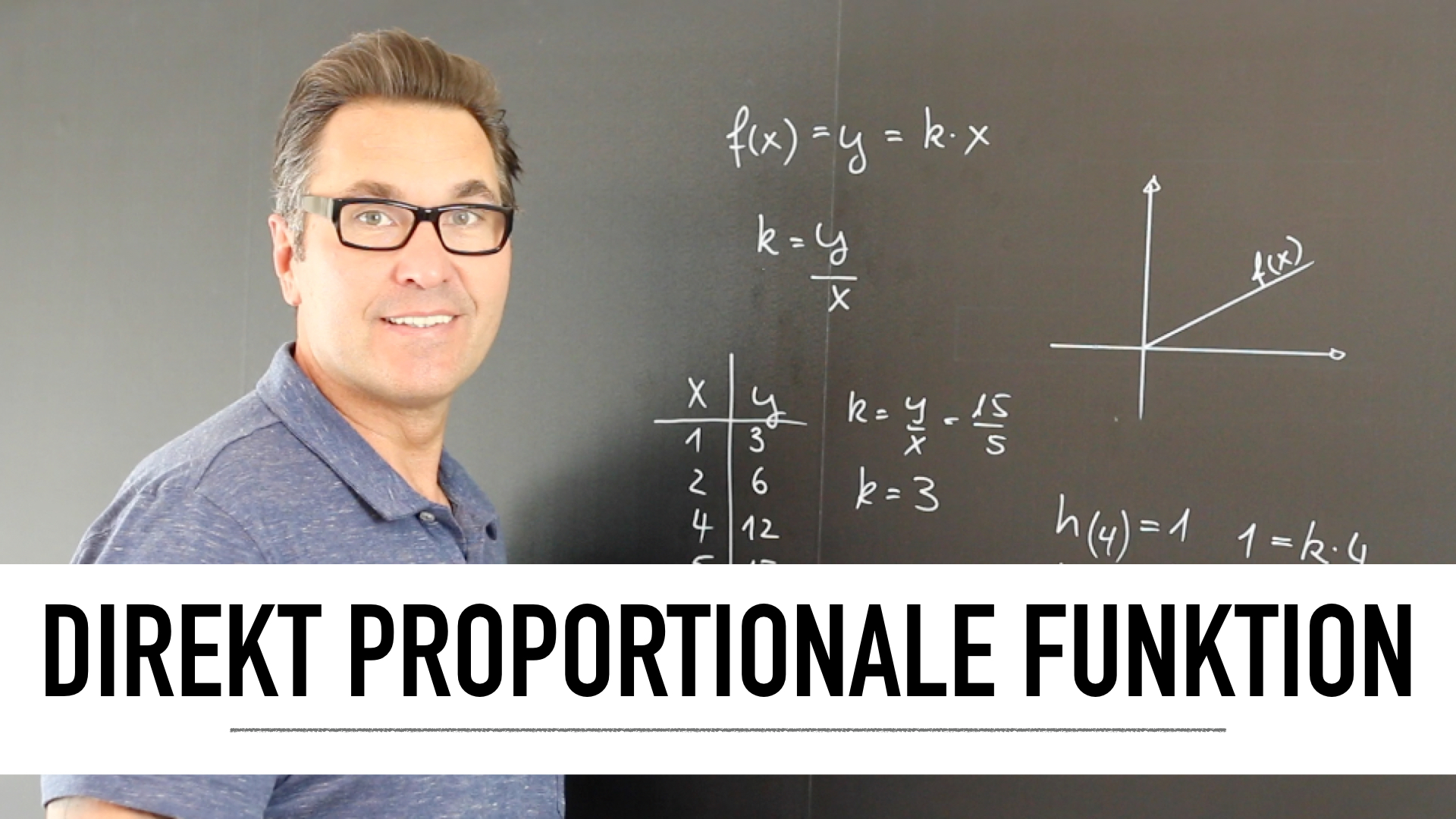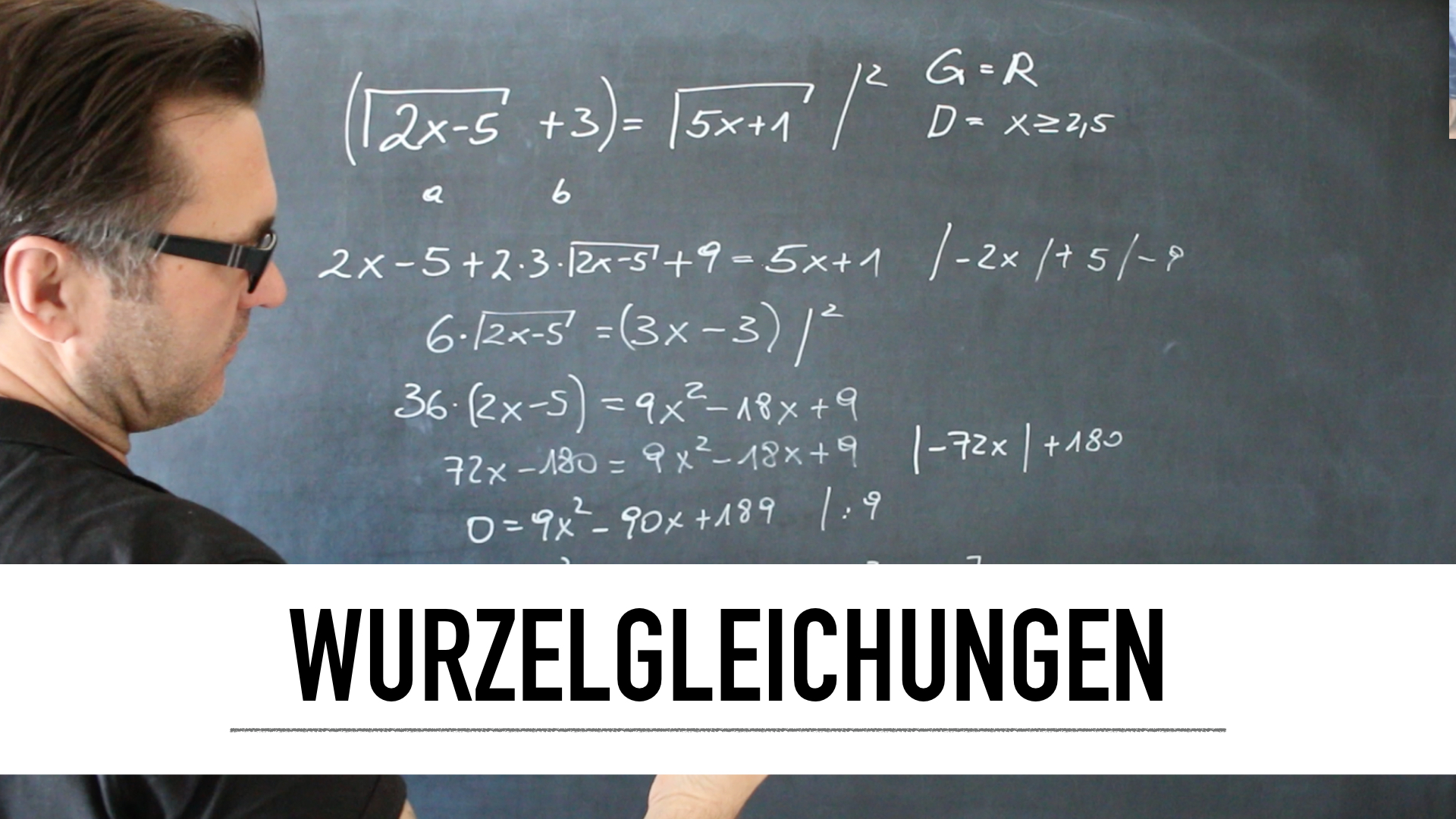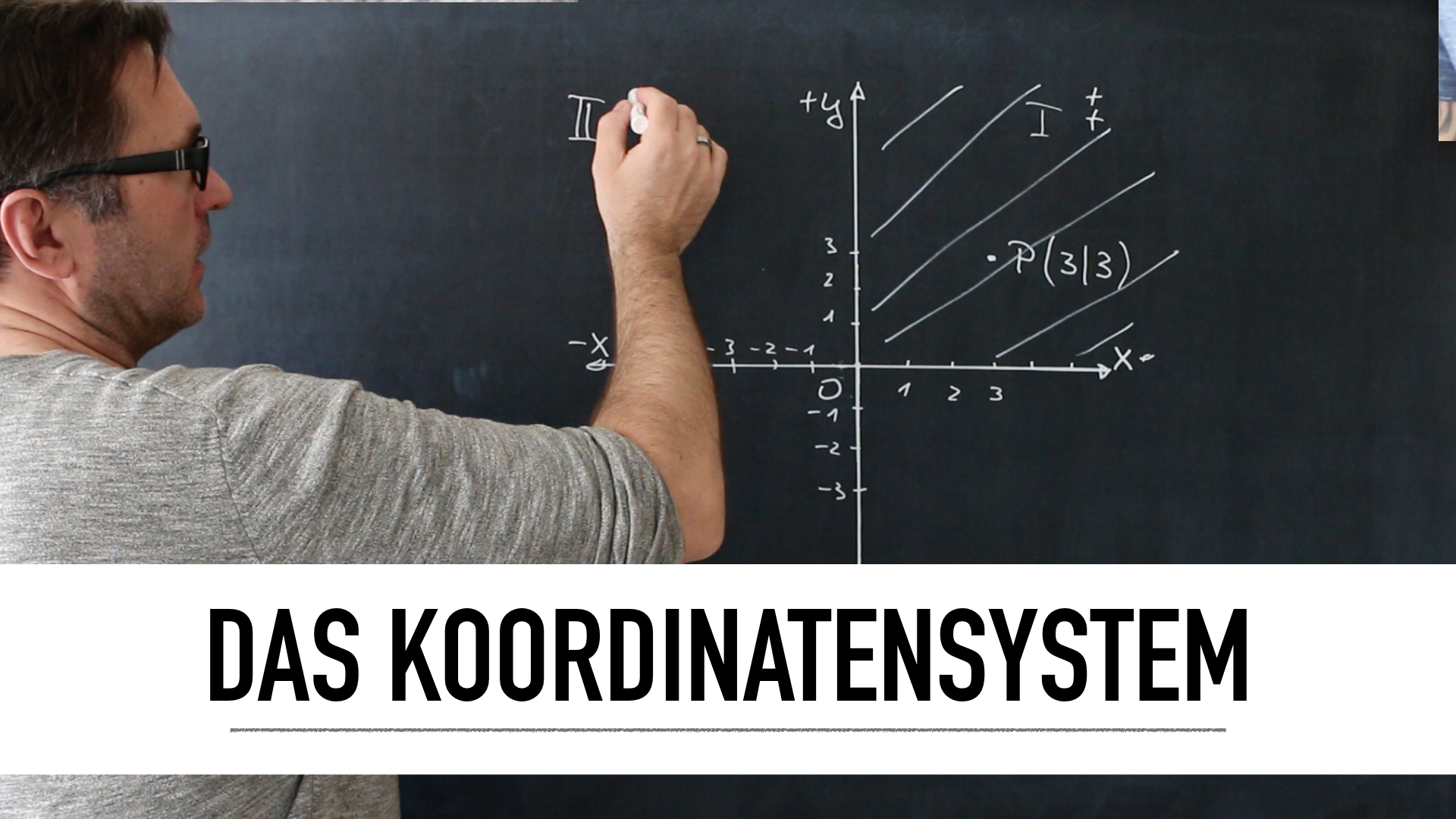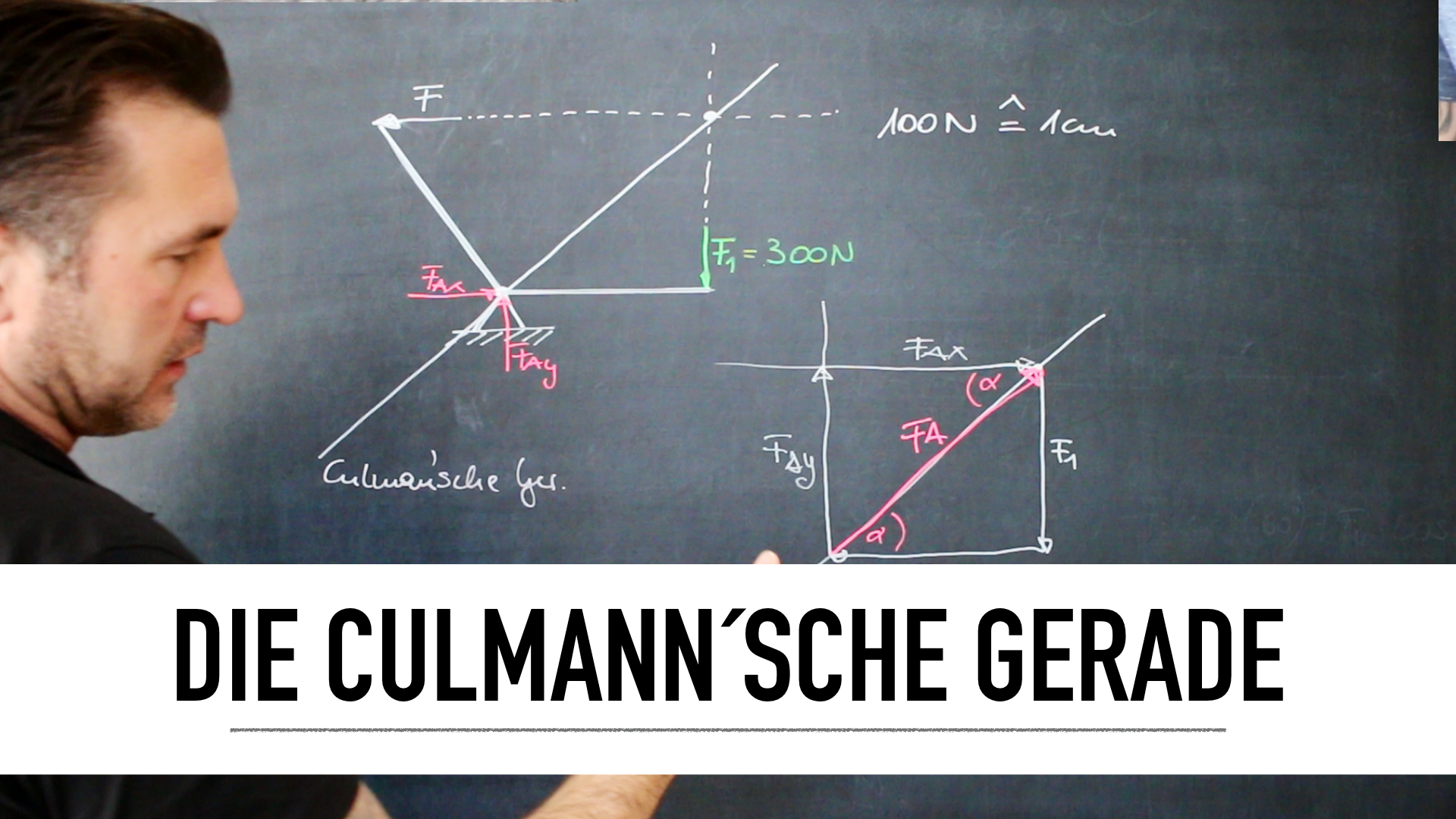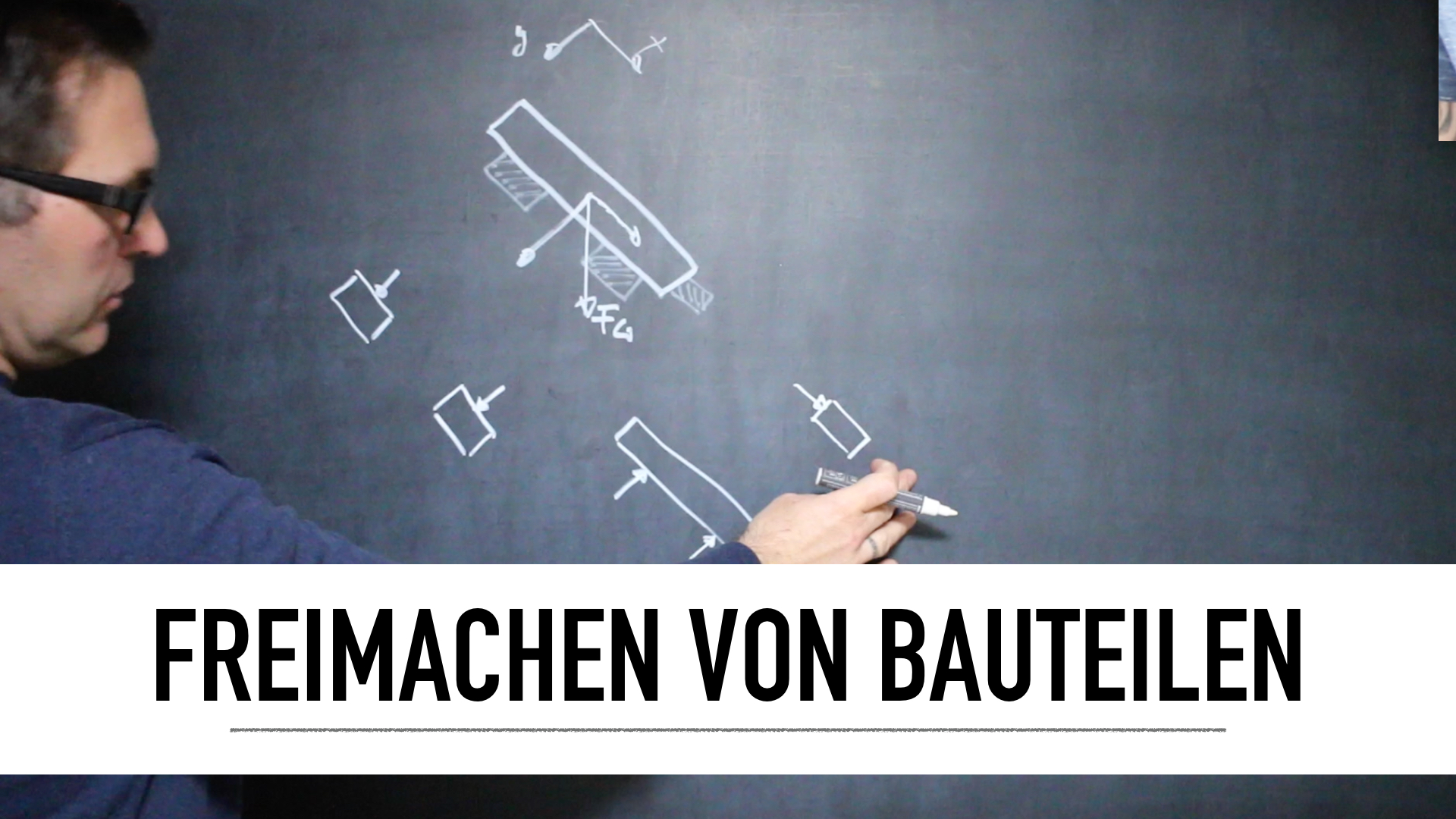Die abschnittsweise definierte Funktion

In der Mathematik ist eine abschnittsweise definierte Funktion (auch stückweise Funktion, hybride Funktion) eine Funktion, die durch mehrere Unterfunktionen definiert ist. Wobei man jede Unterfunktion auf ein bestimmtes Intervall des Bereichs der Hauptfunktion, einen Unterbereich, anwendet. Die abschnittsweise definierte Funktion ist eigentlich eher eine Möglichkeit, die Funktion auszudrücken, als ein Merkmal der Funktion selbst. Aber mit zusätzlicher Qualifikation kann sie die Natur der Funktion beschreiben. Zum Beispiel ist eine stückweise Polynomfunktion eine Funktion, die ein Polynom auf jeder ihrer Unterdomänen ist, aber möglicherweise auf jeder ein anderes Polynom.
Warum abschnittsweise definierte Funktion?
Das Wort abschnittsweise verwendet man auch, um jede Eigenschaft einer stückweise definierten Funktion zu beschreiben. Die für jedes Stück, aber nicht notwendigerweise für die gesamte Domäne der Funktion gilt. Eine Funktion ist stückweise differenzierbar oder stückweise kontinuierlich differenzierbar, wenn jeder Abschnitt in seiner gesamten Subdomäne differenzierbar ist.
Auch wenn die gesamte Funktion an den Punkten zwischen den Abschnitten nicht differenzierbar ist. In der konvexen Analyse kannst du bei abschnittsweisen Funktionen den Begriff der Ableitung durch den des Subderivats ersetzen. Obwohl die „Stücke“ in einer stückweisen Definition nicht Intervalle sein müssen, wird eine Funktion nicht als „abschnittsweise linear“ oder „stückweise kontinuierlich“ oder „stückweise differenzierbar“ bezeichnet, es sei denn, die Stücke sind Intervalle.
Die Treppenfunktionen sind sowohl den einfachen Funktionen als auch den Sprungfunktionen sehr ähnlich. Du solltest sie aber nicht mit diesen verwechseln. So nehmen beispielsweise einfache Funktionen auch nur endlich viele Werte an, können aber trotzdem viel komplexer sein, da sie nicht über Intervalle auf dem Grundraum definiert werden, sondern über messbare Mengen. So ist beispielsweise die Dirichlet-Funktion eine einfache Funktion, aber keine Treppenfunktion im hier genannten Sinne, da sie über abzählbar viele Sprungstellen hat und in keinem noch so kleinen Intervall konstant ist. Außerdem werden einfache Funktionen auf beliebigen Messräumen definiert, wohingegen Treppenfunktionen bloß auf R definiert werden. Allerdings ist jede Treppenfunktion auch immer eine einfache Funktion.
Die Sprungfunktionen sind wie die Treppenfunktionen auch auf den reellen Zahlen definiert. Allerdings sind sie immer monoton wachsend, können aber auch abzählbar viele Sprungstellen haben.
Eine Treppenfunktion ist in der Mathematik eine spezielle reelle Funktion, die nur endlich viele Funktionswerte annimmt und stückweise konstant ist. Dadurch erhält der Funktionsgraph einer Treppenfunktion sein charakteristisches und namensgebendes Aussehen, das einer auf- und absteigenden Treppe ähnelt.