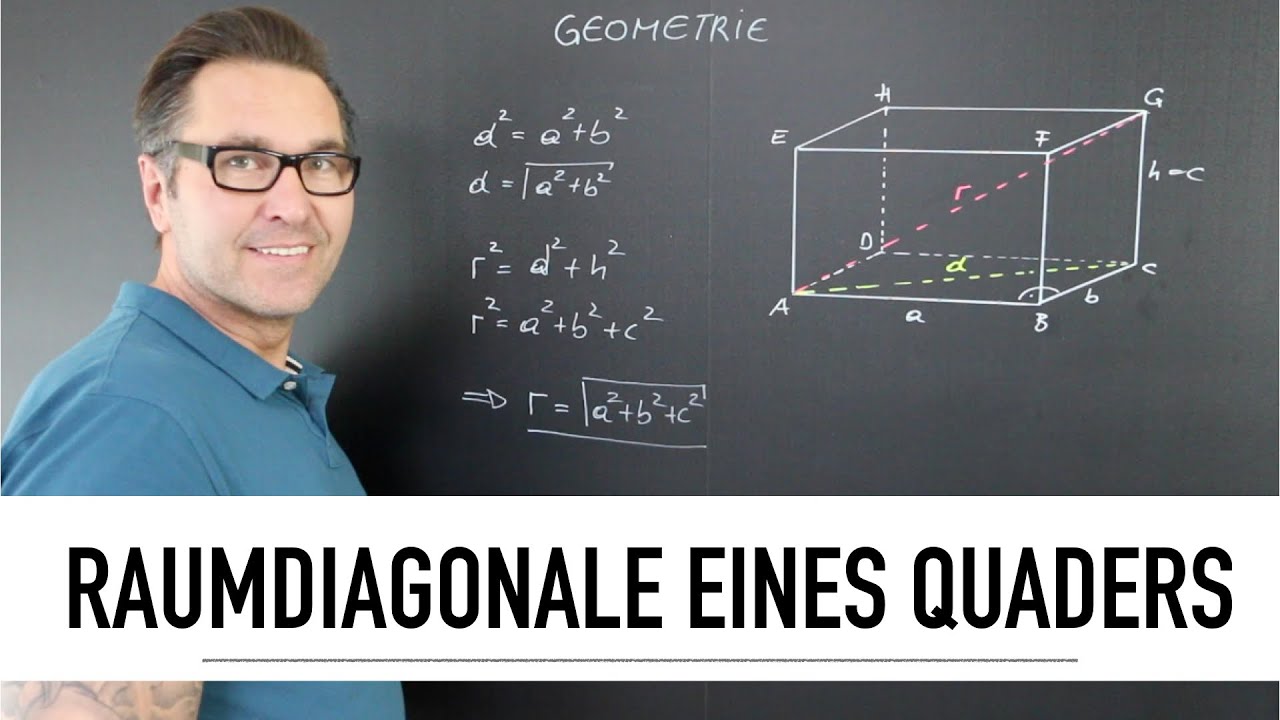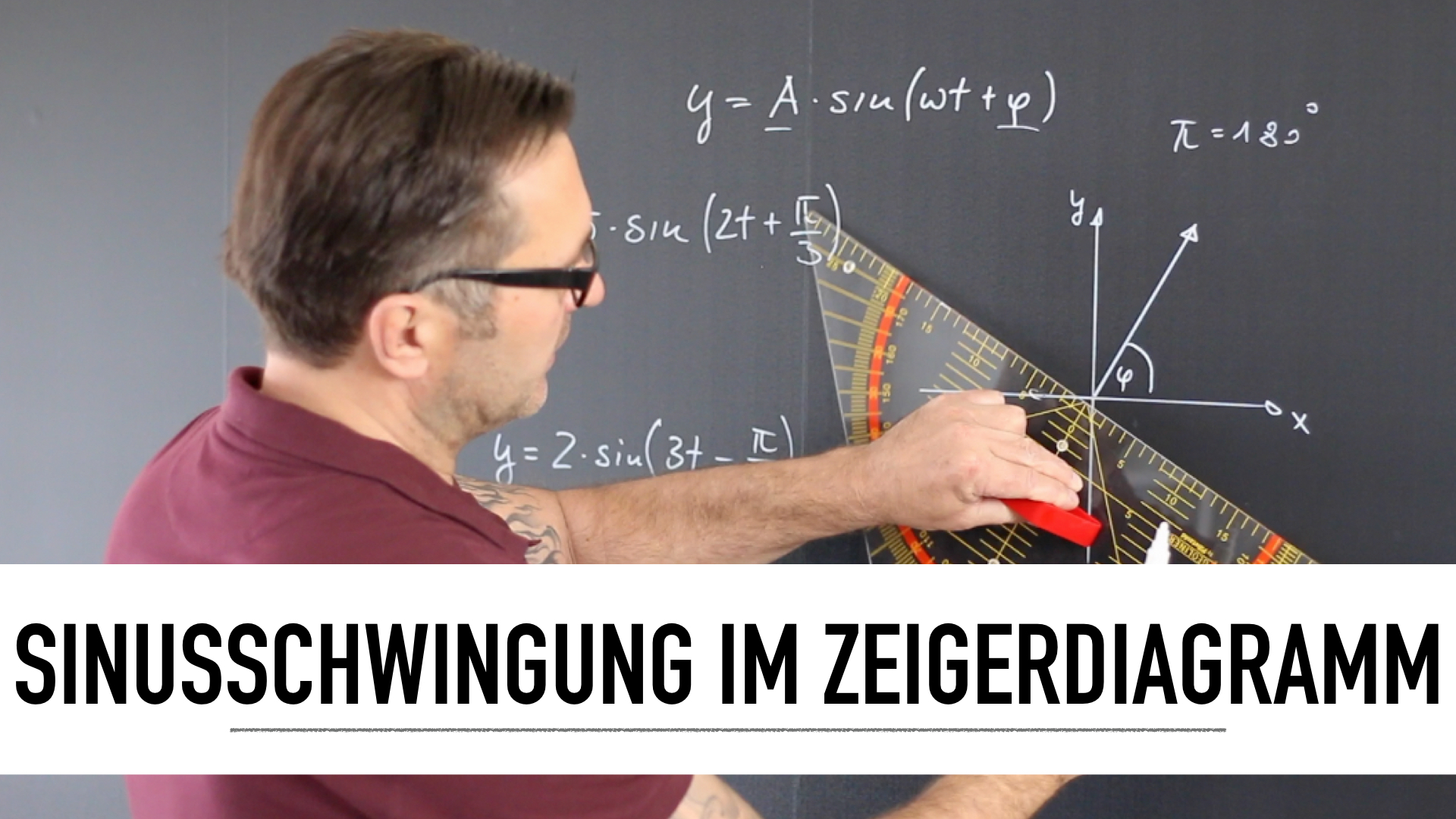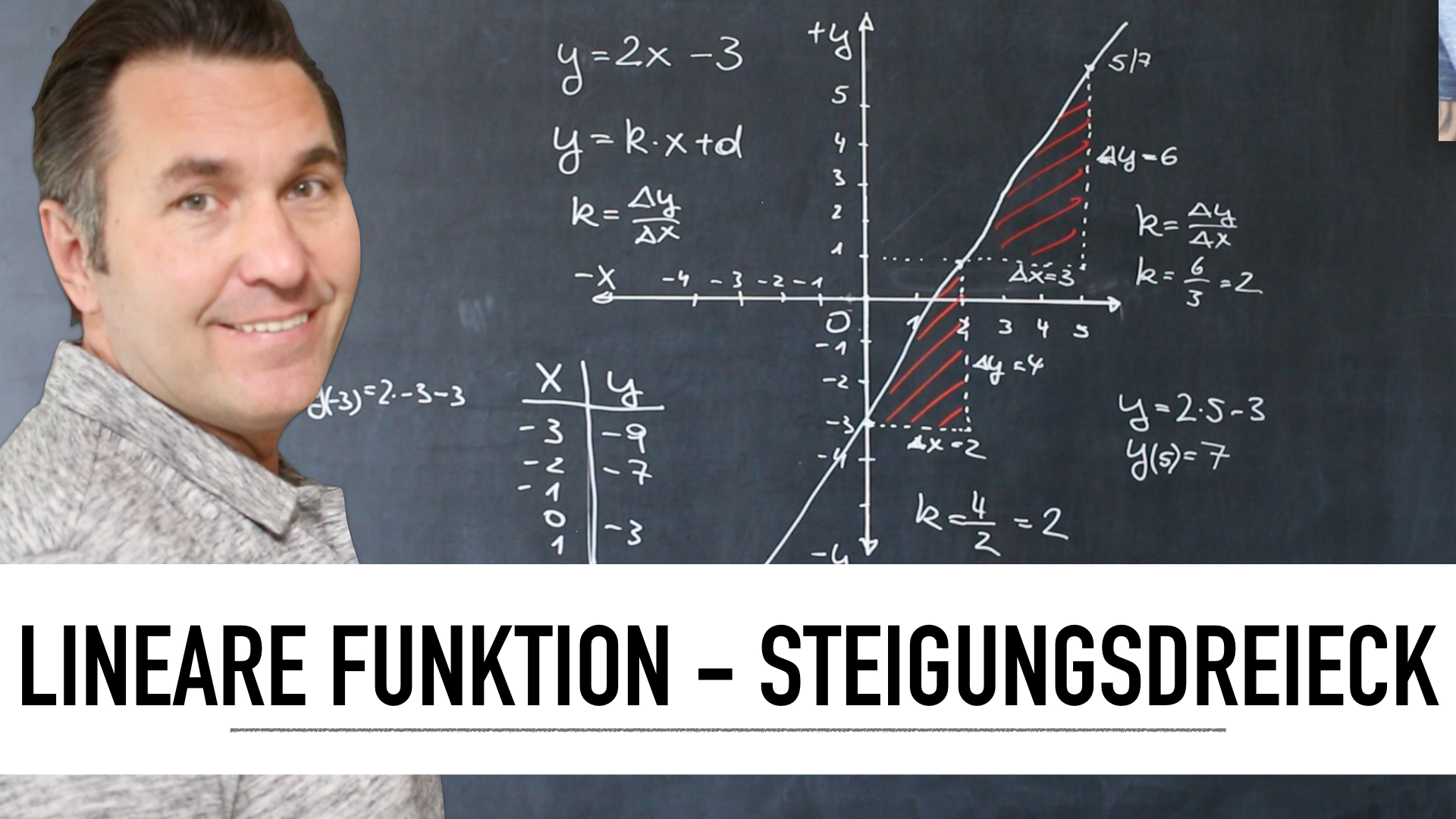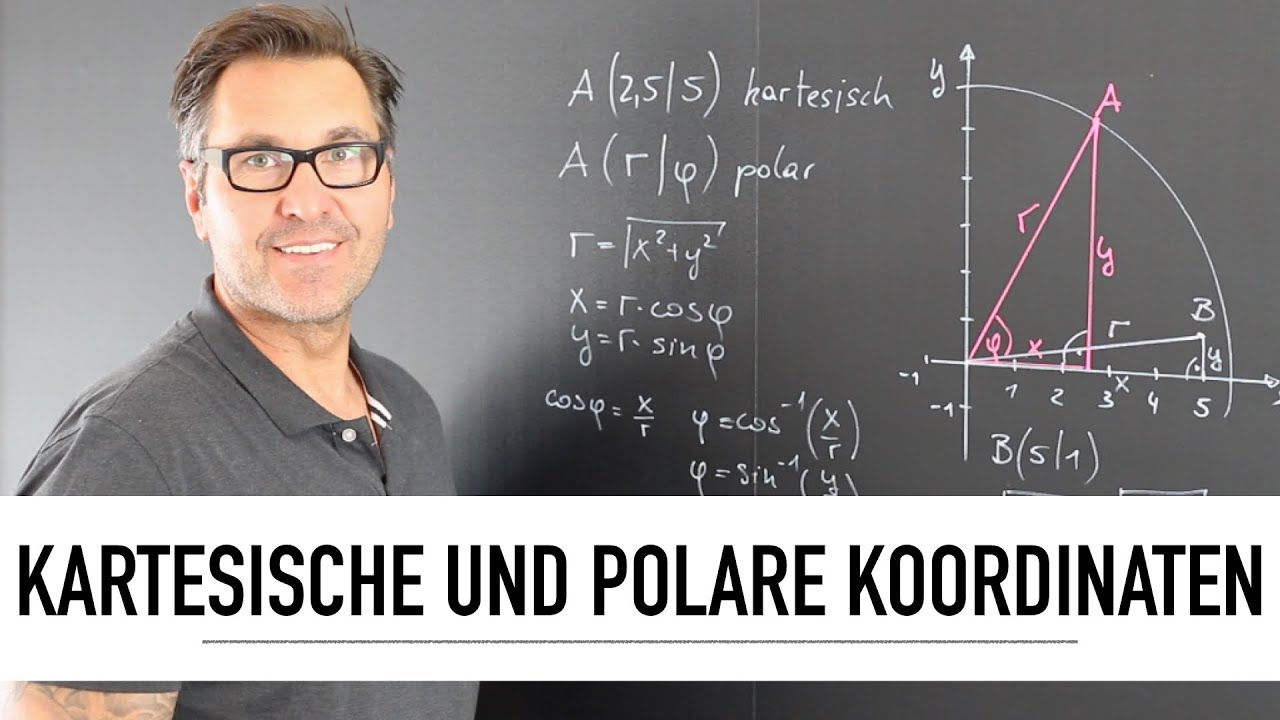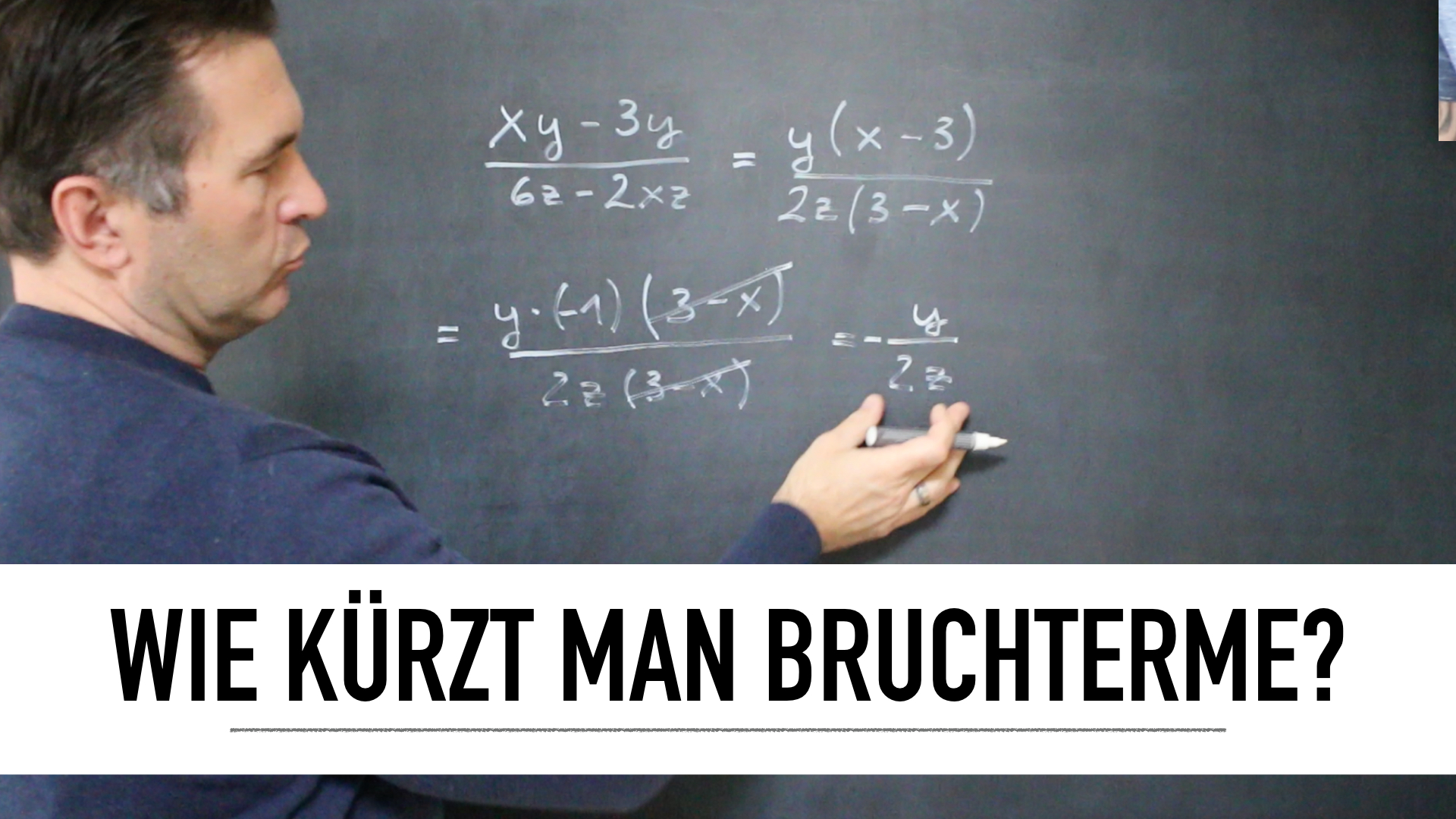Homogene und inhomogene Differentialgleichungen
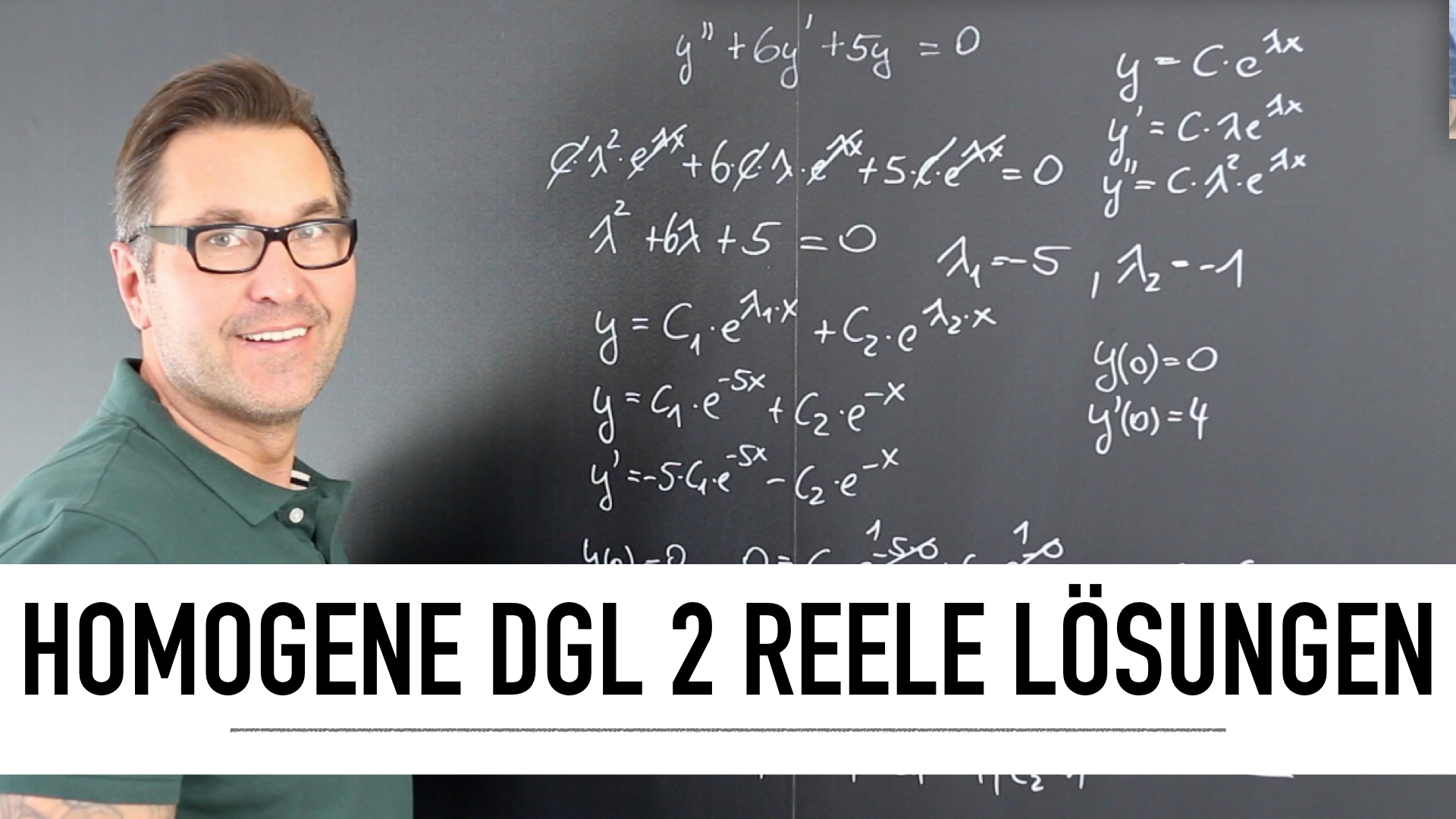
Differentialgleichungen lassen sich in homogene und inhomogene Differentialgleichungen unterscheiden. Die Lösung einer inhomogenen DGL besteht aus der allgemeinen Lösung der homogenen und einer speziellen Lösung (partikuläre Lösung) der inhomogenen DGL. Deshalb erfolgt das Lösungsverfahren der inhomogenen DGL, unabhängig von der Ordnung, in zwei Stufen. Dabei ist die Gesamtlösung die Summe der beiden Lösungen.
Die homogene Lösung der DGL ist Null, wenn alle Anfangsbedingungen und deren Ableitungen Null sind. Die partikuläre Lösung der DGL beschreibt das Übertragungsverhalten als erzwungene Bewegung. Je nach Systemordnung müssen alle Anfangsbedingungen y und deren Ableitungen Null sein. Die partikuläre Lösung der DGL ist in der Regelungstechnik meist von hauptsächlichem Interesse.
Mit Hilfe des Exponentialansatzes und der sich daraus ergebenden charakteristischen Gleichung lassen sich auch DGL höherer Ordnung lösen. Dieser Exponentialansatz gilt als universelles Lösungsverfahren für homogene DGL beliebiger Ordnungen mit konstanten Koeffizienten.
Wie löse ich inhomogene Differentialgleichungen?
Die Variation der Konstanten ist ein Verfahren aus der Theorie linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen. Diese nutzt man zur Bestimmung einer speziellen Lösung eines inhomogenen linearen Differentialgleichungssystems erster Ordnung. Und einer inhomogenen linearen Differentialgleichung beliebiger Ordnung. Vorausgesetzt wird hierfür eine vollständige Lösung (Fundamentalsystem) der zugehörigen homogenen Differentialgleichung.
Wenn du eine inhomogene Differentialgleichung vor dir hast, bestimmst du die Lösung in zwei Schritten: Du berechnest die homogene Lösung und die sogenannte partikuläre Lösung, auch spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung genannt. Zusammen ergeben sie die Gesamtlösung.
Eine inhomogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung lässt sich durch Variation der Konstanten auf folgende Weise lösen. Zuerst löst du die entsprechende homogene Differentialgleichung durch Trennung der Variablen. Um die inhomogene DGL zu lösen, ersetzt du die Integrationskonstante C durch eine unbekannte Funktion C (x). Die Funktionsterme für y und y‘ setzt du in die inhomogene DGL ein. Diesen Ausdruck für C (x) setzt du in die Formel für y ein und erhälst die allgemeine Lösung der inhomogenen DGL. Diese Methode ist als Methode der Variation der Konstanten bekannt. Die Integrationskonstante C wird variiert, das heißt durch eine Funktion C(x) ersetzt.
Das Lösen einer Differentialgleichung höherer Ordnung ist äquivalent zum Lösen eines geeigneten Differentialgleichungssystems erster Ordnung. Auf diese Weise kann man obiges Verfahren nutzen, um eine spezielle Lösung für eine Differentialgleichung höherer Ordnung zu konstruieren.